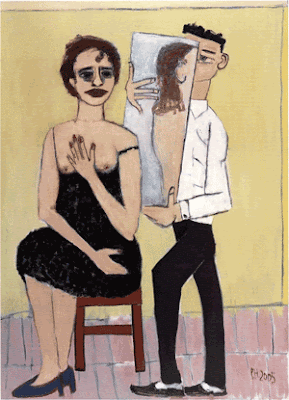Fernand Hörner, Dozent für französische Literatur- und Kulturwissenschaft in Wuppertal, geht davon aus, „dass sich für die Behauptungen des Dandys ein gemeinsames Zusammenspiel verschiedener Taktiken der Behauptung formulieren lässt, ähnlich wie Foucault in der Archéologie du savoir Formationsregeln für einen Wissenschaftsdiskurs formuliert“. Seine Untersuchung setzt einen neuen Maßstab in Sachen wissenschaftliches Dandytum.
Fernand Hörner, Dozent für französische Literatur- und Kulturwissenschaft in Wuppertal, geht davon aus, „dass sich für die Behauptungen des Dandys ein gemeinsames Zusammenspiel verschiedener Taktiken der Behauptung formulieren lässt, ähnlich wie Foucault in der Archéologie du savoir Formationsregeln für einen Wissenschaftsdiskurs formuliert“. Seine Untersuchung setzt einen neuen Maßstab in Sachen wissenschaftliches Dandytum.
„Éternelle supériorité du Dandy. Qu’est-ce que le dandy? (Ewige Überlegenheit des Dandys. Was ist der Dandy?)“, fragte Charles Baudelaire in den Fusées und traf damit den Nagel Dandytum auf den Kopf. Das Dandytum, das wie ein Stachel im Fleisch der Moderne sitzt. Fernand Hörner geht in seiner Studie den Phänomen des dandysme nach: Zu diesen Phänomen gehört, dass das Dandytum permanent für tot erklärt wird und viele Untersuchungen mit dem Fazit enden, das Dandytum sei längst erledigt. Heute könne niemand mehr Dandy sein. Entweder weil der Ur-Dandy George Brummell unkopierbar sei oder weil die moderne Massengesellschaft mit ihrer Mode von der (Kaufhaus)-Stange keinerlei dandyistisches Sein mehr zulasse.
Aufgrund aufwendiger Quellenstudien gelingt es Hörner, die substanzielle Arbeit von Otto Mann Der moderne Dandy, der damit 1924 bei Karl Jaspers promovierte, weiterzuführen. So gelingt ihm die Darstellung, warum Oscar Wilde, trotz seiner Erscheinung als „Karikatur dieses Ideals“ (Gerd-Klaus Kaltenbrunner) eben doch ein waschechter Dandy war. Mit seinem einzigen Roman Dorian Gray erweist Wilde seinen Dandy-Vorfahren vielfache Referenzen. Nicht nur liefert Vivian Grey, der Roman des mit Wilde befreundeten Benjamin Disraeli, den Nachnamen seines Romanjünglings. Die ästhetisch-ausschweifenden Feste von Dorian sind eine Anspielung auf die Feste von Byron in Newstead Abbey. Wilde verweist ausdrücklich auf Gautier, wenn er Dorian beschreibt, für ihn sei das Leben als solches die erste aller Künste. „Dorians Sinn für Ästhetik wird so mit Gautiers Faszination für ästhetische Eindrücke verglichen, wie er sie […] gegenüber den Goncourts zum Ausdruck bringt. Die Definition des Dandyismus als Versuch, die Modernität des Schönen zu erreichen, wiederholt Baudelaires Definition des Dandys, die Wilde auch im Theaterstück A Women of No Importance aufnimmt.“
In vielen eindrucksvollen Teil-Untersuchungen nähert sich der Autor der „Behauptung des Dandys“. Zu dieser Behauptung gehört auch das Übersetzen und sozusagen Über-Setzen. Denn viele Dandys waren zugleich Dandy-Schriftsteller und -Übersetzer. Die kleine, aber große Wirkung erzielende Studie vom exzentrischen Dandy Barbey d’Aurevilly über Brummell basiert in Teilen auf der Anekdoten-Sammlung von William Jesse (The Life of Beau Brummell), die es nicht in Französisch gab. So konnte Barbey die Überlieferungen des Bekannten von Brummell sich selbst nutzbar machen und poetisch-interpretierend weiter-schreiben. Hörner stellt dar, dass es neben dem sprachlichen Transfer, eine wichtige Zeitlang von der englischen in die französische Sprache, auch der personelle Transfer war, der das Dandytum stark beeinflusste: „Viele Franzosen, wie Chateaubriand oder de Stael, verließen Frankreich während der französischen Revolution oder des Empire, kehrten später zurück und brachten ihr Verständnis der englischen Lebensart nach Frankreich. Auf der anderen Seite kamen viele Engländer, um (zumindest zeitweise) in Frankreich zu leben, im Jahr 1830 stieg ihre Zahl auf 31.000. Der mit Brummell befreundete Rees Howell Gronow widmet in seinen Reminiscences and Recollections ein ganzes Kapitel dem Thema ‚An English Dandy in Paris’, in dem er diese Überschneidung der englischen mit der französischen Gesellschaft thematisiert.“
Totgesagte leben länger. Hörner empfiehlt für eine eingehendere Untersuchung ob ihres Dandytums die Künstler Théodore Géricault, Gustave Courbet, Fernand Khnopff, Manet, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Jacques Monory, Gilbert & George und die Professoren der Düsseldorfer Kunstakademie Joseph Beuys, Jörg Immendorff und Markus Lüpertz.
Bei dem Umfang der Studie und dem augenscheinlichen Aufwand, den Hörner betrieben hat, wäre es absolut kleinlich, auf manchmal fehlende Quellen hinzuweisen. Die Untersuchung kann durchaus als bahnbrechend bezeichnet werden. Vorliegende Werke wie die von Hans-Joachim Schickedanz (Ästhetische Rebellion und rebellische Ästheten, 2000) oder Günter Erbes Dandys – Virtuosen der Lebenskunst (2002) werden vollkommen in den Schatten gestellt. Vom Tiefgang der Untersuchung ist die neue Studie am ehesten vergleichbar mit Hiltrud Gnügs fulminanter literaturwissenschaftlicher Arbeit Kult der Kälte von 1988. Aber diese beschränkt sich eben auf einen recht kleinen Ausschnitt.
Fernand Hörners profundes Quellenwerk setzt im Moment den Maßstab in Sachen wissenschaftliches Dandytum. Es ist Ansporn, an vielen Punkten weiterzuforschen. Bleibt die Frage: Qu’est-ce que le dandy?
Fernand Hörner: Die Behauptung des Dandys. Eine Archäologie. Transcript Verlag 2008. 354 S., Euro 34,80.
 Zum heutigen Todestag von Joachim Ringelnatz (7. August 1883 – 17. November 1934) sprach dpa mit dem Göttinger Philologie-Professor Frank Möbus. Er bezeichnet den Kabarettisten Joachim Ringelnatz im Privaten als zurückhaltenden Menschen mit dandyesken Zügen.
Zum heutigen Todestag von Joachim Ringelnatz (7. August 1883 – 17. November 1934) sprach dpa mit dem Göttinger Philologie-Professor Frank Möbus. Er bezeichnet den Kabarettisten Joachim Ringelnatz im Privaten als zurückhaltenden Menschen mit dandyesken Zügen.