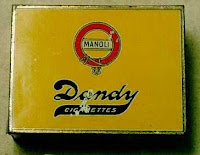Gefunden auf facebook.
Jan. 29
Being Lagerfeld
Jan. 28
Die Geburt der Sinnlichkeit aus dem Geist der Askese
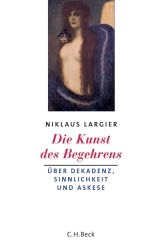 Der DANDY-CLUB rezensiert
Der DANDY-CLUB rezensiert
Niklaus Largiers Die Kunst des Begehrens. Über Dekadenz, Sinnlichkeit und Askese. C.H. Beck Verlag, München 2007, 187 Seiten.
Dekadenz und Askese figurieren üblicherweise als Gegensätze. Genauer: Eigentlich als diametral Entgegengesetztes. Askese meint den Verzicht auf alles Unnötige, auf alles, was von der wahren Bestimmung ablenkt. Kontemplation, Einkehr, Meditation lauten die Begriffe, die Wegweiser von Bewusstwerdung sind.
Der Begriff der Dekadenz hat im Gegensatz zu dem der Askese eine Problematik per definitionem in sich: Er ist negativ konnotiert. Dekadenz meint die sinnlose, ja gar nihilistische Verschwendung. Genuss ohne Reflektion. Der US-amerikanische Germanist Niklaus Largier zeigt nun in einer furiosen Untersuchung, dass Dekadenz und Askese nicht nur keine Gegensätze sind. Seine These: Das was üblicherweise als dekadent bezeichnet wird, ist nichts anderes als eine Art der Askese.
Gegenstand des essayistischen Buches ist der Kult des exquisiten Genusses, der in der Regel als dekadent bezeichnet wird. Der auch in der Schweiz ausgebildete Hochschullehrer nennt es eine »Geschichte der Geburt der Sinnlichkeit aus dem Geist der Askese«. Und in der Tat: Largier verdeutlicht in seiner atemberaubenden Studie, warum Dekadenz und Askese Kinder derselben Eltern sind. In beiden Fällen geht es darum, das normale, das von der Umwelt geführte Leben zu ignorieren, um andere Erfahrungen für sich selbst zu ermöglichen.
Anhand vieler Beispiele aus Joris-Karl Huysmans’ Bibel der Dekadenz (Paul Valéry) À rebours (Gegen den Strich) versinnbildlicht Largier die Substanz dekadenter Verhaltensweisen. Diese werden häufig von der Gesellschaft als ‚dekadent’ bezeichnet, weil sie diese ablehnen muss. Würde doch der Utilitarismus der bürgerlichen Welt in sich zusammenbrechen, bestünden viele Menschen auf ein derart ausgerichtetes, manche nennen es ein selbstbestimmtes, Leben.
Der in Berkeley lehrende Autor arbeitet durch seine tiefgreifende Quellenanalyse heraus, dass die dekadenten Szenarien von Huysmans’ Protagonisten Jean Floressas Duc Des Esseintes eben in Wahrheit nichts anderes sind als der Rückzug des Mönchs in die Zelle. Auch wenn es von außen betrachtet ganz anders aussieht. Der junge Adlige in Huysmans’ Roman zieht aus dem pulsierenden Paris der Mitte des 19. Jahrhunderts in ein von ihm bis ins kleinste Detail durchgestyltes Refugium. Seine Diener müssen Filzpantoffeln tragen, um ihn nicht zu stören. Er schafft sich ein künstliches Paradies, in dem es für ihn unnötig werden soll, das Haus zu verlassen, um die Welt kennenzulernen. Er besitzt eine bilbliophile Bibliothek, in der er Tage und Nächte lesend und träumend verbringt. Er braut sich eigene Gerüche, schafft künstliche Pflanzen und experimentiert mit allerlei verschiedenen Drogen.
Von mediokren Geistern ist das Buch heftig kritisiert worden ob seiner ‚Lebensverneinung‘. Largier stellt auf substantielle Weise klar: Das Gegenteil ist der Fall. Huysmans kannte die mittelalterliche Literatur, in der die Innen-Außen-Unterscheidung thematisiert worden ist. Und der ironische französische Schriftsteller mit dem holländischen Namen macht aus seinen Anregern keinen Hehl, stellt er sie doch alle in die Bibliothek seines degenerierten Dandyhelden. Des Esseintes ging es eben nicht um ein Zurschaustellen von Besitz und Reichtum. Er umgibt sich mit dem Schönsten und Erlesensten, weil nur so ihm das Leben überhaupt erträglich wird. Nur mit dem Mantel dieser Dinge ist es ihm möglich, seine Seele die Erfahrungen machen zu lassen, die in diesem Leben anstehen. »Der Rückzug des Mönchs in die Zelle, der Umzug des Gelehrten ins studiolo, die Isolation des dekadenten Genießers in der luxuriösen Villa – all dies produziert das Dämonische und die Ästhetisierung, indem es die Natur herausfordert und die Einheitlichkeit ihrer Artikulation in Frage stellt «, folgert der Autor.
Die Neue Züricher Zeitung hat in einer Annonce des Buches – ironisch – dessen Verbot gefordert: »Denn«, schreibt die NZZ, »laut ihren Promotoren zielt die Bologna-Reform auf die ‚Verwirklichung eines wettbewerbsfähigen und dynamischen Hochschul- und Forschungsraums in Europa’. Da das anzuzeigende Werk aber zum Denken und Nachdenken anregt, sollte es von allen, deren intellektuelles Lebensziel Dynamik und Wettbewerb ist, mit Nichtbeachtung gestraft werden.«
© Matthias Pierre Lubinsky. All rights reserved.
Jan. 28
Roger Willemsen bei Harald Schmidt
Wie wir soeben erfahren, ist als heutiger Gast in der Harald Schmidt-Show der Publizist und bekennende Fernseh-Kritiker Roger Willemsen abgekündigt.
Sendeanstalt: ARD.
Zeit: 23.30 Uhr.
Es lohnt sicher, den beiden geistreichen deutschen Fernseh-Feuilletonisten zu lauschen.
Jan. 27
Living Lagerfeld III
 Photo: Copyright Karl Lagerfeld. All rights reserved.
Photo: Copyright Karl Lagerfeld. All rights reserved.
Gefunden: http://www.artinfo.com/news/story/28303/living-lagerfeld/
Jan. 26
Amerikanische Dandys?
Der Yankee Doodle Dandy ist eine historische Figur aus dem amerikanischen Bürgerkrieg
Das intelligente deutsche Kultur-Blog SILVAE geht der Frage nach, ob es US-amerikanische Dandys gibt und gab:
„Amerikanische Dandies? Es muss sie gegeben haben“, schreibt Jay von SILVAE. Er folgert: „Denn das berühmte Lied „Yankee Doodle“, das in der Zeit der amerikanischen Revolution überall gesungen wird, spricht in Zeile drei und vier von stuck a feather in his cap/and called it macaroni und in Zeile zwei des Refrains von Yankee Doodle Dandy. Nun hat macaroni hier nichts mit einem italienischen Gericht zu tun, es ist vielmehr eine Bezeichnung für einen Dandy, die im England des 18. Jahrhunderts allgemein gebräuchlich wird.“
 James Cagney als Yankee Doodle Dandy
James Cagney als Yankee Doodle Dandy
Weiter gehts hier:
http://loomings-jay.blogspot.com/2010/01/amerikanische-dandies.html
Jan. 26
Zigaretten-Ausstellung
 Die deutsche Zigaretten-Industrie warb Anfang des 20. Jahrhunderts einfallsreich und modern für ihre Produkte.
Die deutsche Zigaretten-Industrie warb Anfang des 20. Jahrhunderts einfallsreich und modern für ihre Produkte.
Im Jüdischen Museum in Berlin lief im vergangenen Jahr eine Kabinetts-Ausstellung über die deutsche Zigaretten-Industrie und deren wegweisende Werbung zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist leider vorbei. Aber wir bringen noch das Photo zur Schau. Denn das ist sehr sehenswert.
Die Seite der Sonderausstellung des Jüdischen Museums:
http://www.jmberlin.de/main/DE/01-Ausstellungen/02-Sonderaustellungen/2008/manoli.php
Danke G.S.!
Photo: Copyright Jüdisches Museum Berlin. All rights reserved.
Jan. 26
Living Lagerfeld II
 Photo: Copyright Karl Lagerfeld. All rights reserved.
Photo: Copyright Karl Lagerfeld. All rights reserved.
Gefunden: http://www.artinfo.com/news/story/28303/living-lagerfeld/
Jan. 25
Männer, Frauen und Dandys
 Der DANDY-CLUB rezensiert
Der DANDY-CLUB rezensiert
Melanie Grundmann: Dandiana. Der Dandy im Bild englischer, französischer, und amerikanischer Journalisten des 19. Jahrhunderts, 208 Seiten, Münster 2009.
Ewige Überlegenheit des Dandys.
Was ist der Dandy?
fragte Charles Baudelaire in seinen tagebuchähnlichen Aufzeichnungen. Der Pariser Bohème gab damit Zeugnis von seiner Suche nach dem wahren Kern, der Essenz des Dandytums, – aber zugleich auch von der durch ihn selbst betriebenen Mystifizierung und Stilisierung.
Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Melanie Grundmann ist bemüht, Licht ins Dunkel namens Dandy zu bringen. Nach ihrer vor drei Jahren vorgelegten Anthologie Der Dandy – Wie er wurde, was er war nun das kleine Bändchen Dandiana mit dem Untertitel Der Dandy im Bild englischer, französischer und amerikanischer Journalisten des 19. Jahrhunderts. Nach eigener Angabe hat die Forscherin 129 Artikel, Gedichte, Briefe und Reisebeschreibungen ausgewertet. Durchaus Interessantes, Erhellendes kommt dabei zutage. So erfährt man, dass der Dandy zu Beginn des 19. Jahrhunderts in englischen Zeitschriften als »thing«, als geschlechtsloses Ding bezeichnet wurde. Melanie Grundmann zitiert einen Leserbrief aus dem Jahr 1822:
»What things are they of doubtfull gender, Tipp’d at each end with brass, and slender Like broomstick of the witch of Endor? They’re dandies.«
Die Autorin fand einen Leserbrief, in dem die Menschheit gar in drei Gruppen eingeteilt wird: Männer, Frauen und Dandys.
Durch die vielen angeführten Zitate wird deutlich, dass mit dem »Dandy« im 18. und im anfänglichen 19. Jahrhundert wenig Positives verbunden wurde. Der damit konnotierte Typus galt als clownesk-auffällig, man sah ihn an als jemanden, der um jeden Preis im Mittelpunkt stehen wollte. Seine sexuelle Uneindeutigkeit vergrößerte die Irritation noch. In vielen von der Autorin herausgesuchten journalistischen Texten wird der Dandy als dümmlich und ästhetisch unsicher klassifiziert. Witzig zu lesen ist das Kapitel Ein Tag im Leben eines Dandys. Es sind Artikel aus britischen Zeitungen und Magazinen, die Melanie Grundmann sprechen lässt. Es sind diese Berichte, die – häufig nicht ganz ernst gemeint – das Bild über diese Lebensform stark mitgeprägt haben. Die Schreiber ereiferten sich bereits bei der Uhrzeit, wann ein Dandy für gewöhnlich aufstehe. Ein Artikel wusste von 12.00 Uhr zu berichten, ein anderer von 1 Uhr und ein dritter war sicher, ein echter Dandy würde nicht vor 17.00 Uhr sein Bett verlassen. Nach dem geruhsamen Frühstück ließ der Dandy freilich nach seinem Schneider und dem Korsettmacher schicken.
Weitere Themen des Büchleins sind die Impertinenz des Dandys, seine Empfindsamkeit und Schwäche, sein stolzes Gebaren oder der Reiz des Bösen. Interessant ist die Akzentverschiebung bei der Nutzung der Zuschreibung »Dandy«. Vom anfänglich, das bedeutet in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, sehr negativen Image, wurde die Verwendung des Wortes eher differenzierter. Nicht verwunderlich ist die jeweils unterschiedliche Konnotation in den verschiedenen Ländern. So wurden englische Gentlemen, die sich bewusst frankophil gaben, gern als unpatriotisch beschimpft. Melanie Grundmann kommt zum Ergebnis, das heutige Bild des Dandys sei zu korrigieren. »Die Forschungsliteratur, die sich zumeist auf literarische Texte stützt, die das Bild des Dandys verklären und idealisieren, betrachtet den Dandy im Großen und Ganzen als einen heroischen, kühnen und stoischen Mann von Welt, der sich in ästhetischer Kontemplation ergeht«, resümiert Grundmann. Ist das nicht eine schöne Vorstellung, an die die Menschen glauben möchten? Und die Modemagazine machen doch nichts anderes wie heute das Fernsehen-? Sie lieferten und liefern ihren Lesern den unerreichbaren Glamour einer romantisierten Glitzerwelt?
Die Autorin rückt zurecht, was teilweise unkritisch übernommen worden ist und so Eingang in den Wissenschafts-Kanon gefunden hat. Erst in den vergangenen Jahren erschienen hervorragende Untersuchungen, wie die von Fernand Hörner, die historische Quelltexte mit Distanz rezipierten und ihre Rezeptionsgeschichte mit analysierten. Melanie Grundmanns lesenswerte kleine Studie endet – mit einer Frage: »Wann und wie trat der Wandel im Bild des Dandys ein, der ihn von einer lächerlichen Erscheinung zu einem heroischen Helden werden ließ, welcher sich gegen die Nivellierungstendenzen der Moderne aufbäumte?« Ihre Vermutung, dass Schriftsteller hierbei eine entscheidende Rolle spielten, scheint zuzutreffen. So habe Balzac die Dandys früh als affektiert bezeichnet und später »in seinen Romanen vollendete Dandy-Figuren« geschaffen.
Melanie Grundmanns Verdienst ist, die bisherige, überschaubare Literatur zum Dandytum in deutscher Sprache durch viele weitere Quelltexte aus der originären Zeit des Hochkommens essentiellen Dandytums zu bereichern.
Die große Monographie über den dandysme ist noch nicht geschrieben. Sie könnte einen Markierungspunkt setzen bei Ernst Jünger, der an sehr wenigen aber anscheinend umso bedeutenderen Stellen in seinem umfangreichen Tagebuch Stellung bezog und über sein eigenes Leben und Schaffen resümierte: »Meine heutige Wertung ist nicht politischer, sondern stilistischer Natur. Insofern scheint mir, daß ich damals unter mein Niveau gegangen bin, aber nicht deshalb, weil ich mich als Nationalist, sondern weil ich mich überhaupt beteiligte.«
Jan. 25
Living Lagerfeld
 Karl Lagerfeld liebt die deutsche Plakat-Kunst der 1920er und 30er Jahre.
Karl Lagerfeld liebt die deutsche Plakat-Kunst der 1920er und 30er Jahre.
Photo gefunden:
http://www.artinfo.com/news/story/28303/living-lagerfeld/
Photo: Copyright Karl Lagerfeld. All rights reserved.
Jan. 25
Manoli Dandy

Lucien Bernahard entwarf dieses Werbe-Plakat für die Berliner Zigaretten-Marke Manoli um 1909. Ein hochwertiges Reprint gibt es hier:
http://cgi.ebay.de/Manoli-Berlin-1913-Dandy-Zigaretten-Plakat-Faksimile-62_W0QQitemZ370317623516QQcmdZViewItemQQptZDesign_Stil?hash=item5638a680dc
Danke annA-C.!
Rechts: Manoli-Zigerettendose, Berlin 1908-1914. Deutsches Historisches Museum.